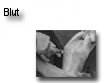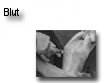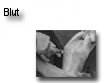

- Die glomeruläre Filtrationsrate (GFR) ist
ein Indikator der funktionellen Nierenmasse. Serumkreatinin und -harnstoff
werden als Einschätzung der GFR in der Klinik angewandt.
- Serum Kreatinin: Kreatinin ist ein spontanes,
nicht enzymatisches Abbauprodukt von Phosphokreatinin im Muskel. Die Produktionsrate
ist proportionl der Muskelmasse und bleibt demzufolge bei gleicher Muskelmasse
für dasselbe Individuum relativ konstant. Kreatinin wird unverändert
in den Nierenglomeruli filtriert und weder sezerniert noch resorbiert. Sinkt
die GFR, so erhöht sich das Serumkreatinin. Damit es aber zu einer
solchen Erhöhung kommen kann, müssen mindestens zwei Drittel der
Nierenmasse nicht mehr funktionstüchtig sein.
- Serum Harnstoff: Harnstoff wird in der Leber
(Ornithinzyklus) aus Ammoniak gebildet. Er wird durch die Glomeruli filtriert
und von den Tubuli passiv rückresorbiert und sezerniert. Die passive
Resorptions-, bzw. Sekretionsrate ist von der relativen Flussrate vom Blut
in den peritubulären Kapillaren, sowie von der tubulären Flüssigkeit
in den Tubuli abhängig. Eine Hämokonzentration infolge Exsikkose
verlangsamt den Blutfluss in den peritubulären Kapillaren und erlaubt
eine erhöhte Resorption. Im Gegensatz kann eine Polyurie/Polydypsie
durch einen erhöhten Fluss in den Tubuli die Rückresorption von
Harnstoff erschweren. Der Harnstoffspiegel im Serum ist demnach u.a. von
der Eiweisszufuhr im Futter, vom Energiestoffwechsel des Körpers, vom
Flüssigkeitsgleichgewicht, sowie von der Leberfunktion abhängig.
Die Aussagekraft von Veränderungen der Harnstoffkonzentration im Blut
für die Einschätzung der Nierenfunktion ist somit weniger eindeutig
als beim Kreatinin.